|
|
 |

DAS
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE TANDEM,
DIE AUßEN- UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK
. |
 |
| |
Auch
wenn die außenpolitische Ausrichtung Frankreichs sich von der Deutschlands
unterscheidet, so wurde doch seit 1945 eine wachsende Übereinstimmung
erreicht.
. |
| Die
französische Außenpolitik hat ihre internationalen Ambitionen bewahrt,
die deutsche Außenpolitik hat sich dafür mehr auf die Integration
in Europa und generell auf die Westenanbindung hin konzentriert. Nichts
desto weniger ist Deutschland seit der achtziger Jahren bestrebt,
sich auf dem internationalen Parquet eine Position zu verschaffen,
die seiner wirtschaftlichen Stärke Rechnung trägt; so 1992, als Deutschland
sich im Rahmen der Reform der UNO um einen ständigen Sitz mit Veto-Recht
im Weltsicherheitsrat bemühte. Frankreich hat dieses Bemühen schließlich
als legitimes Anliegen unterstützt; trotz alledem scheint die Zeit
noch nicht reif für eine Reform der UNO-Institutionen. |
 |
|
Einige geschichtliche Tatsachen wie die ständige Mitgliedschaft
Frankreichs im Weltsicherheitsrat, Frankreichs Status als Atommacht
seit 1960, sein Rückzug aus der integrierten Kommandostruktur der
NATO 1966, sowie die der deutschen Bundeswehr auferlegten Beschränkungen
nach dem letzten Krieg sind ursächlich für nach wie vor bestehende
Meinungsverschiedenheiten in der Bewertung der internationalen Grosswetterlage
und der unmittelbar davon abhängenden Verteidigungspolitik.
Nach dem Ende des kalten Krieges mußte Deutschland sich mit zwei
verschiedenen Bestrachtungshorizonten im Bereich der Verteidigungs-
und Außenpolitik auseinandersetzen: Jene der USA, welche die Verteidigung
im Rahmen der NATO sichert und jene Frankreichs, die versucht eine
mit dem deutschen Nachbarn abgestimmte Politik voranzutreiben.
.
|

|
Trotz
des Fehlschlags der Europäischen Verteidigungsunion im August 1954,
haben das Abkommen von Paris, das die Westeuropäische Union (WEU)
im Oktober 1954 institutionalisierte, und der Eintritt Westdeutschlands
in die NATO 1955 es den beiden Ländern gestattet, ihre Außen- und
Verteidigungspolitik einander anzunähern. |
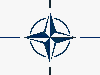 |
|
Die Geburt der Europäischen Wirtschaftgemeinschaft (EWG) mit der
Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25.März 1957 markiert einen
wichtigen Schritt in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern;
trotz seines stark wirtschaftlichen Charakters öffnete der Vertrag
den Weg zu einer zukünftigen politischen Annäherung der Mitgliedsstaaten
der Gemeinschaft und vor allem zwischen Frankreich und Deutschland,
das dafür schon ein wichtiger Motor war. Und in der Tat manifestierte
sich diese politische Annäherung in der Unterzeichnung der einheitlichen
europäischen Akte 1986 und dann im Vertrag von Maastricht 1992,
der eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die
Einrichtung einer gemeinsamen Verteidigung (Art. J.4) vorsah.
Frankreich und Deutschland haben sich sowohl bei den Maastrichter
Verhandlungen als auch auf der Regierungskonferenz in Turin, die
zum Abkommen von Amsterdam im Juni 1997 führte, dafür eingesetzt
gemeinsame Vorschläge zu erarbeiten, besonders im Bereich der Außen-
und Verteidigungspolitik.
Die beiden Länder stehen einer größeren politischen Eigenständigkeit
Europas, hinsichtlich der GASP, wohlwollend gegenüber. Der gemeinsame
Vorschlag im Rahmen der Regierungskonferenz sah dazu die Einrichtung
eines „Herrn GASP" vor, ebenso wie die Einführung qualifizierter
Mehrheiten bei diesen Fragen. All diese Vorschläge waren dazu konzipiert
die mäßigen Ergebnisse der Union im Bereich der Außenpolitik (während
des Konflikts in Ex-Jugoslawien beispielsweise) zu beheben, die
durch Malfunktionen der Entscheidungsmechanismen und die mangelnde
Verlagerung von Entscheidungsbefugnis auf die europäische Ebene
hervorgerufen wurden.
.
|
| Das
deutsch-französische Paar bildet den Kern der europäischen Verteidigungsidentität.
Im November 1987 wurde die deutsch-französische Brigade gegründet
(5.000 Mann); die damit gemachten positiven Erfahrungen führten 1992
zur Einrichtung des deutsch-französischen Eurocorps, dem sich in der
Folge Belgien, Luxemburg und Spanien (50.000 Mann) anschlossen. Auch
wenn diese Einheit für Einsätze im Rahmen der NATO geeignet ist, steht
sie nicht unter NATO-Kommando. Sie kann auch im Rahmen der WEU eingesetzt
werden. |
 |
|
Das Eurocorps
wird als Vorreiter einer zukünftigen europäischen Verteidigung eingeschätzt,
die sich im Vertrag von Maastricht abzeichnet. Das Eurocorps stellt
auch einen der ersten Bausteine einer europäischen Verteidigungsidentität
dar. Diese Erfahrungen haben andere europäische Verteidigunginitiativen
favorisiert, die auch andere Länder mit einschliessen wie beispielsweise
die Euromarfor im Mittelmeerraum oder die französisch-britische
Flugstaffel. Die Teilnahme des Eurocorps an internationalen Einsätzen
ist künftig möglich aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht
vom 12. Juli 1994, wonach das Verbot eines Einsatzes deutscher Soldaten
außerhalb Deutschlands bzw. der NATO-Zone teilweise aufgehoben wurde.
Dadurch konnte die deutsch-französische Brigade auch ihren Beitrag
zur Friedensmission (IFOR) in Bosnien im Dezember 1996 leisten.
In dieselbe Richtung ging 1995 die Schaffung einer deutsch-französischen
Rüstungsagentur, die seit November 1996 als europäische Rüstungsagentur
unter Einschluß von Großbritannien und Italien entsteht. Wichtigstes
Ziel dieser Agentur besteht in der Koordination von Forschung und
Bau von Waffen auf europäischer Ebene. Ferner ist eine Restrukturierung
der Rüstungsindustrie auf europäischer Ebene zu verzeichnen, um
der internationalen Konkurrenz begegnen zu können. Die Unterzeichnung
eines Abkommens über den Bau der Spionagesatelliten Elios 2 und
Oros im Dezember 1995 zwischen Deutschland und Frankreich, aber
auch mit Spanien, und Italien ordnet sich in dieselbe Logik ein.
Das gemeinsame deutsch-französische Verteidigungskonzept, das anläßlich
des Gipfels von Nürnberg am 9.Dezember 1996 beschlossen wurde, drückt
klar den Willen der beiden Länder aus, eine konzertierte Verteidigung
entstehen zu lasssen. Die Erarbeitung eines gemeinsamen strategischen
Konzeptes soll eine deutsch-französische
Verteidigungsgemeinschaft in europäischer und atlantischer Perspektive
etablieren. Bei dieser Gelegenheit haben Jacques Chirac und Helmut
Kohl auch ihre gemeinsame Analyse hinsichtlich der NATO-Osterweiterung
sowie über die Notwendigkeit einer Neudefinition der Beziehungen
zu Rußland abgegeben. Dieses Übereinkommen zeigt deutlich die Verstärkung
der deutsch-französischen Beziehungen auf diesem Gebiet; es bringt
ebenfalls eine der wichtigsten Übereinstimmungen in den Beziehungen
auf diesem Gebiet seit 40 Jahren zum Ausdruck. Tatsächlich hatte
der Fehlschlag des militärischen Teils des Elysée-Vertrags von 1963
- trotz der Reaktivierung des deutsch-französischen Sicherheits-
und Verteidigungsrates durch Präsident Mitterrand und Kanzler Kohl
1988 - keine Vertiefung des gemeinsamen strategischen Konzepts zwischen
beiden Ländern erlaubt.
Der partielle Rückzug der USA aus Europa in den neunziger Jahren
sowie die Annäherung zwischen Frankreich und der NATO seit 1995
haben die Konvergenz der Standpunkte zwischen Deutschland und Frankreich
begünstigt. Nichtsdestoweniger geschieht diese Annäherung an die
NATO nicht ohne Bedingungen von Seiten Frankreichs; in der Tat wünscht
Frankreich, daß Europa, dessen Verteidigungsidentität anläßlich
des NATO-Treffens am 3. Juni 1996 anerkannt wurde, im Zentrum dieser
Organisation verstärkte Verantwortung übernimmt.
So sehr die politische Einigung dazu bestimmt ist, Europa auf internationaler
Ebene eine Position zuzuordnen, die seiner wirtschaftlichen Macht
entspricht, so macht die Schaffung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik
die deutschen und französischen Interessen unauflöslich. Diese 'Gemeinschaft
der Sichtweisen' findet ihren verlängerten Arm in der europäischen
Einigung, für die sie der wichtigste und unerlässliche Impulsgeber
ist.
|
© Alle Rechte vorbehalten
 |

